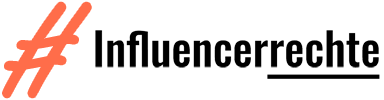Influencer sind keine rechtsfreien Meinungspiraten. Wer andere öffentlich angreift, kann sich schnell im juristischen Sturm wiederfinden – auch ohne Hashtag #Werbung.
Was passiert, wenn Influencer im Netz verbal aufeinander losgehen? Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat hierzu kürzlich eine differenzierte Entscheidung getroffen und dabei deutlich gemacht, wo die Grenze zwischen geschützter Meinungsfreiheit und unzulässiger Persönlichkeitsverletzung verläuft – und wann das Wettbewerbsrecht nicht greift.
Drama in der Timeline – jetzt auch vor Gericht! Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte in einem Urteil vom 17.07.2025 (Az. 16 U 80/24) über einen Zoff zwischen zwei Influencern zu entscheiden. Und dabei wurde klar: Wer öffentlich über andere austeilt, muss im Zweifel auch rechtlich einstecken.
Der Hintergrund: Streit zwischen zwei bekannten Streamern
Im Zentrum des Falls standen zwei Social-Media-Persönlichkeiten, die beide auf Plattformen wie YouTube, Twitch, Instagram, TikTok und X (ehemals Twitter) aktiv sind. Die Klägerin ist insbesondere für politischen und gesellschaftskritischen Content bekannt und engagiert sich unter anderem für Frauenrechte und die LGBTQ-Community. Auch Gaming-Inhalte gehören zu ihrem Repertoire.
Ein Influencer hatte sich in einem Video nicht gerade charmant über eine Influencer-Kollegin geäußert – sagen wir mal so: Die Worte waren deutlich und wenig schmeichelhaft. Die betroffene Influencerin sah ihr Persönlichkeitsrecht verletzt und zog vor Gericht.
Der Beklagte produziert ebenfalls regelmäßig Inhalte für diverse Plattformen. In einem YouTube-Video äußerte er sich kritisch – und teilweise heftig – über die Klägerin. Bereits in einem vorangegangenen Verfahren vor dem Landgericht Frankfurt war es zu einer Untersagung bestimmter Aussagen gekommen. Im aktuellen Berufungsverfahren stand nun die Frage im Raum, ob weitere Äußerungen untersagt werden müssen – und ob auch das Wettbewerbsrecht Anwendung finden kann.
Keine wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsansprüche unter Influencern – aber Persönlichkeitsrechte bleiben geschützt.
Persönlichkeitsrechtlicher Schutz: Teils ja, teils nein
Das OLG stellte klar: Die Klägerin kann sich durchaus gegen bestimmte Aussagen zur Wehr setzen – insbesondere dann, wenn ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht betroffen ist und dieses schwerer wiegt als die Meinungsfreiheit des Beklagten.
Das sagt das Gericht: Ja, solche Äußerungen können das allgemeine Persönlichkeitsrecht verletzen – und dann gibt’s rechtlich einen Dämpfer: Unterlassung!
Konkret darf der Beklagte künftig nicht mehr behaupten, die Klägerin „hetze Tag ein, Tag aus“, ihr Geschäftsmodell sei es, „Hass und Fake News zu verbreiten“, oder sie würde anderen fälschlicherweise sexuelle Belästigung unterstellen. Für diese Aussagen konnte der Beklagte keine Belege vorlegen – es handelt sich laut Gericht um unwahre Tatsachenbehauptungen, die nicht vom Schutz der Meinungsfreiheit gedeckt sind.

Lernen Sie unsere deutschlandweiten Standorte kennen.
Anders sieht es bei rein wertenden Äußerungen aus. Solche Meinungen, etwa dass die Klägerin „Hass verbreite“ oder ein „mysogenes Verhalten“ zeige, müssen in einem demokratischen Meinungsklima grundsätzlich hingenommen werden – so das Gericht.
Wer also über andere öffentlich herzieht, riskiert, dass er das künftig per Gerichtsbeschluss lassen muss. Aber: Einen wettbewerbsrechtlichen Anspruch gab es nicht. Warum? Ganz einfach: Die beiden Influencer standen nicht im Wettbewerb miteinander. Und die Aussagen waren keine geschäftlichen Handlungen – also keine Werbung, kein Produktvergleich, kein Marketing-Trick. Nur (ziemlich unschönes) Gerede.
Kein Wettbewerbsverhältnis – keine wettbewerbsrechtlichen Ansprüche
Besonders interessant ist das Urteil mit Blick auf das Wettbewerbsrecht: Die Klägerin hatte zusätzlich versucht, den Beklagten auf Grundlage des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) in Anspruch zu nehmen. Doch damit hatte sie keinen Erfolg.
Das Gericht stellte fest, dass zwischen den Parteien kein konkretes Wettbewerbsverhältnis besteht. Zwar bewegen sich beide im gleichen digitalen Umfeld und buhlen im weiteren Sinne um Aufmerksamkeit – das allein genügt jedoch nicht. Es sei nicht ersichtlich, dass der eine durch seine Aussagen wirtschaftliche Nachteile beim anderen herbeiführen wollte oder konnte. Zudem fehlte es an einer sogenannten geschäftlichen Handlung: Die Äußerungen des Beklagten dienten nicht der Förderung eigener Leistungen oder Produkte, sondern waren redaktioneller Natur – also Ausdruck seiner persönlichen Sichtweise, eingebettet in einen unterhaltenden Kontext.
Auch der Umstand, dass beide durch Spenden oder Werbung Einnahmen erzielen, ändere daran nichts. Eine konkrete wirtschaftliche Konkurrenzsituation liege nicht vor – zumal die Klägerin im Verfahren erklärt hatte, dass sie ihr Engagement größtenteils ehrenamtlich betreibe.
Meinung ja – gezielte Diffamierung nein
Das Urteil bringt Klarheit in einem zunehmend aufgeheizten Bereich des öffentlichen Diskurses: Auch Influencer müssen sich an rechtliche Grenzen halten, insbesondere wenn es um Persönlichkeitsrechte geht. Das Wettbewerbsrecht ist dagegen nicht das richtige Instrument, um sich gegen persönliche Angriffe zu wehren – es greift nur dann, wenn wirtschaftliche Interessen und geschäftliche Handlungen im Spiel sind.
Die Entscheidung des OLG Frankfurt wurde im Eilverfahren getroffen und ist nicht anfechtbar.